August 26, 2025
No items found.
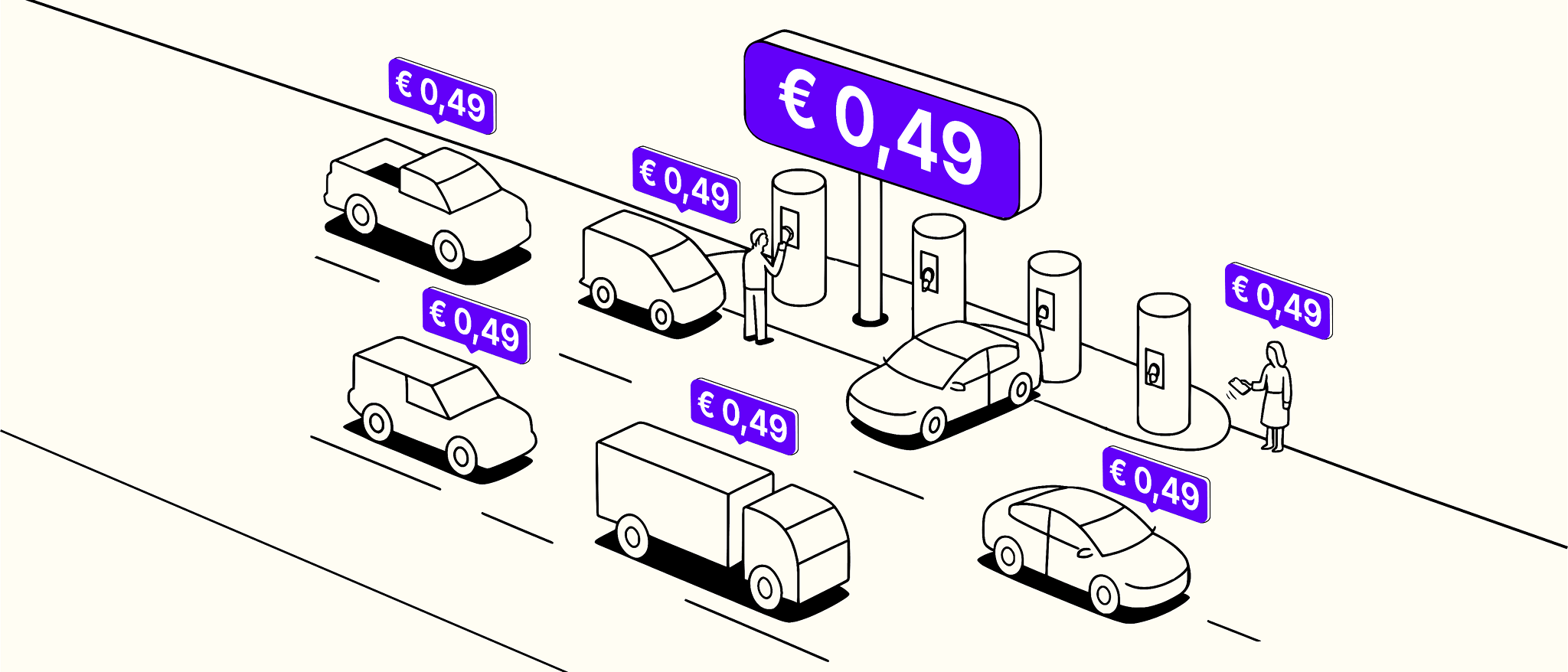
Die Ladebranche für Elektroautos hat die erste Hälfte des Interoperabilitätsproblems weitgehend gelöst. Protokolle wie OCPI und OICP funktionieren. Roaming-Hubs haben die technische Schwerarbeit geleistet, um Ladepunktbetreiber (CPOs) und eMobility Service Provider (EMPs) miteinander zu verbinden. Die Leitungen stehen, die Elektronen können fließen.
Doch während die technische Ebene weitgehend funktioniert, ist die kommerzielle Ebene weiterhin defekt. Die Nachfrage nach E-Autos zieht nach der Flaute von 2024 wieder an, aber viele CPOs sind noch weit von profitablen Geschäftsmodellen entfernt. Schuld daran sind nicht die Protokolle, sondern das Reseller-Modell, das aktuell bestimmt, wie Laden abgerechnet, bepreist und verrechnet wird.
Das Reseller-Modell, bei dem Zwischenhändler Strom von CPOs einkaufen und ihn an Endkunden weiterverkaufen, ist für die Margen ein doppelter Schlag.
Erstens wird der Endkundenpreis durch Roaming-Aufschläge künstlich verteuert. Das dämpft die Nachfrage und verzögert den Return on Investment. Zweitens werden CPOs – insbesondere kleinere und mittelgroße Betreiber – häufig unter Druck gesetzt, hohe Rabatte im Großhandel einzuräumen, teilweise unter der direkten oder indirekten Drohung, sonst gar nicht mehr in den Kanälen gelistet zu werden. Am Ende bleibt ihnen die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen: entweder niedrige Auslastung bei überteuerten Endkundenpreisen oder mehr Auslastung auf Kosten massiver Verluste pro Kilowattstunde.
So entsteht ein Teufelskreis: höhere Preise im Endkundengeschäft, niedrigere Margen im Großhandel – und beides bremst das Wachstum der Auslastung und verlängert die Amortisationszeiten.
Selbst dort, wo Preissensitivität als Steuerungshebel genutzt werden könnte, fehlt den meisten CPOs der Zugang: Der Großteil ihres Volumens läuft über Kanäle, in denen nicht sie, sondern die Zwischenhändler die Endpreise festlegen. Damit werden gezielte Rabatte, zeitabhängige Tarife oder Wettbewerbsstrategien wirkungslos oder bleiben für den Kunden komplett unsichtbar.
Viele Betreiber versuchen deshalb, die Fahrer über eigene Apps oder Ladekarten wieder stärker an sich zu binden, um die Preishoheit zurückzugewinnen und die Abhängigkeit von Drittanbietern zu reduzieren. Doch dieser Ansatz hat Nachteile: Er schränkt die Reichweite ein, fragmentiert die Kundenerfahrung und bremst letztlich genau das, was für die Profitabilität entscheidend ist – das Wachstum der Netzauslastung.
Für E-Autofahrerinnen und -fahrer bedeutet das ein massives Vertrauensproblem: Die gleiche Ladesession kann je nach App, Karte oder Portal völlig unterschiedlich viel kosten. In Deutschland liegen die durchschnittlichen Roaming-Aufschläge bei über 25 %, in Extremfällen sind Preisunterschiede von bis zu 70 % für denselben Ladepunkt möglich. Über 60 % der Fahrer vergleichen deshalb mehrere Apps, bevor sie laden, und fast die Hälfte hat schon einmal eine Ladesession abgebrochen, nachdem sie überhöhte Preise entdeckt hat.
Das ist das „Schatzsuche“-Problem: eine nervige und zeitraubende Suche nach dem besten Preis, die das Tanken mit Benzin plötzlich simpel (und günstig) wirken lässt.
Das Problem betrifft weit mehr als nur die Margen der CPOs. Hohe und vor allem uneinheitliche Preise beim öffentlichen Laden treiben die tatsächlichen Betriebskosten von E-Autos in die Höhe – und bremsen die Verbreitung genau in den Kundensegmenten, die eigentlich den Beginn der Massenadoption tragen sollten: Fahrer mit geringerem Einkommen und solche ohne eigene Ladeoption zu Hause oder am Arbeitsplatz.
OEMs spüren diese Folgen direkt über langsamere Verkaufszahlen, besonders in hart umkämpften Segmenten. Flottenbetreiber und Mobilitätsanbieter kämpfen zusätzlich mit schwer kalkulierbaren Energiekosten, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) schwieriger planbar und das Routenmanagement weniger effizient macht.
Regulierung ist keine Zukunftsfrage mehr, sondern Realität. Die AFIR verändert den Markt bereits heute mit klaren Vorgaben zu transparenter und diskriminierungsfreier Preisgestaltung. Jedes Modell, das für denselben Ladevorgang ohne sachliche Begründung unterschiedliche Preise vorsieht, wird früher oder später regulatorisch angreifbar.
Auch auf der Zahlungsseite sind die Regeln eindeutig: PSD2 zieht eine klare Grenze. Wer Geld im Auftrag eines Dritten einsammelt, ohne über eine entsprechende Lizenz als Zahlungsinstitut zu verfügen, gilt rechtlich als Zahlungsintermediär. Geschäftsmodelle, die auf dem Einsammeln von Geldern und anschließender Weiterleitung beruhen, können damit schnell in den Anwendungsbereich der Regulierung fallen – und sind ein Risiko, wenn die Zahlungsflüsse nicht korrekt strukturiert sind.
Das sind keine theoretischen Debatten, sondern geltende Vorschriften. Verstöße können zu finanziellen Strafen, operativen Einschränkungen oder sogar zum Verlust des Marktzugangs führen.
Im Reseller-Modell werden CPOs nur selten direkt beim Ladevorgang bezahlt. Die Abrechnung erfolgt oft erst Wochen oder sogar Monate später – abhängig vom Zahlungsplan des Zwischenhändlers. Für Betreiber bedeutet das Liquiditätslücken, die vor allem kleinere CPOs stark belasten. Hinzu kommt ein permanentes Ausfallrisiko: Geht ein Zwischenhändler in die Insolvenz oder bestreitet Rechnungen, sieht der CPO das Geld für bereits gelieferte Energie womöglich nie. Für ein kapitalintensives Infrastrukturgeschäft ist das kein kleines Ärgernis, sondern ein strukturelles finanzielles Risiko.
Selbst wenn die Zahlungen eingehen, ist der Prozess selten unkompliziert. Ein CPO, der mit 80 Partnern verbunden ist, muss unter Umständen jeden Monat 80 separate Rechnungen ausstellen – jeweils im richtigen Format, mit korrekter Mehrwertsteuerbehandlung und den passenden steuerlichen Angaben je nach Ladeort und Zulassung des Gegenübers als Energielieferant. Diese Komplexität erzeugt nicht nur enorme administrative Aufwände, sondern erhöht auch die Fehleranfälligkeit, das Risiko regulatorischer Verstöße und die Wahrscheinlichkeit von Streitfällen. Es ist eine versteckte Kostenfalle des Reseller-Modells, die mit zunehmender Netzgröße wächst – und damit genau jene Effizienzgewinne untergräbt, die Skalierung eigentlich bringen sollte.
Das Reseller-Modell ist zudem anfälliger für Betrug, insbesondere wenn Ladevorgänge erst im Nachhinein durch die Fahrer bezahlt werden. Gestohlene oder kopierte RFID-Karten, geteilte App-Zugangsdaten oder unautorisierte Ladevorgänge können dazu führen, dass Umsätze gar nicht erst eingezogen werden. Ohne eine unmittelbare finanzielle Abwicklung zwischen Fahrer und CPO lassen sich solche Vorfälle schwer schnell erkennen – wodurch betrügerische Aktivitäten oft länger unentdeckt bleiben und die Verluste steigen.
Es gibt bereits Fälle, in denen sich die Schäden auf mehrere Hunderttausend Euro summierten. In manchen Fällen haben Betrüger sogar als angebliche EMPs mit Scheinfirmen Zugang zu Roaming-Netzwerken erhalten, Zahlungen von Fahrern kassiert und sind anschließend verschwunden – ohne je die CPOs zu vergüten. Die grenzüberschreitende Forderungseintreibung ist in solchen Szenarien extrem schwierig, mit komplexen rechtlichen Hürden und hohen Kosten verbunden. In den meisten Fällen bleibt CPOs nichts anderes übrig, als die Verluste abzuschreiben.
Die Branche braucht eine strukturelle Lösung. Die Lösung ist ein Plattformmodell, das auf dem Bestehenden aufbaut – den technischen Interoperabilitätsprotokollen – und eine zusätzliche Ebene ergänzt: kommerzielle Interoperabilität.
In diesem Modell behalten CPOs die volle Preishoheit und bestimmen selbst die Tarife, die Fahrerinnen und Fahrer sehen. Entscheidend ist, dass diese Kontrolle weit über die eigene App, Ladekarte oder Ad-hoc-Zahlung hinausgeht. Egal, ob der Ladevorgang über ein In-Car-System, einen Drittanbieter oder ein Ad-hoc-Bezahlsystem gestartet wird – die kommerzielle Logik des CPOs bleibt erhalten.
Damit können CPOs auslastungsorientierte Preisstrategien kanalübergreifend einsetzen, nicht nur in ihrem eigenen Ökosystem. Jeder Kontaktpunkt zum Kunden wird so zu einer Möglichkeit, Nachfrage zu steuern, Erlöse zu maximieren und eine konsistente, vertrauenswürdige Nutzererfahrung zu schaffen.
Ein solches Modell muss zudem von Grund auf regulatorisch konform sein. Der „Merchant of Record“ bleibt immer der CPO, womit PSD2-Risiken ausgeschlossen werden. AFIR-Transparenz ist integriert – ein harmonisierter Preis über alle Kanäle, egal ob vor Ort oder in der App. Wer auf Agenturmodelle oder Preisabsprachen mit EMPs setzt, sollte wissen: Diese Lösungen sind hochgradig PSD2-anfällig und führen zu Komplexität, die nicht skalierbar ist.
Ein Plattformmodell darf kein abstraktes Branchenkonzept bleiben – es braucht einen Orchestrator, der die technische Ebene der Interoperabilität mit der kommerziellen Ebene von Preisgestaltung, Zahlung und Abrechnung verbindet. Genau diese Rolle übernimmt Cariqa.
Cariqa sorgt dafür, dass Interoperabilitätsprotokolle mit Zahlungsprozessen synchron laufen. Jede Ladesession wird mit dem richtigen Tarif, der korrekten Steuer und den passenden Settlement-Logiken abgewickelt. So entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen technischer Konnektivität und finanzieller Abrechnung.
Die CPOs bleiben in voller Kontrolle über ihre kommerzielle Strategie. Sie können entscheiden, wie sie ihre Tarife ins System einspielen – über das OCPI-Tarifmodul, über Cariqas flexibles Pricing-Engine oder eine Kombination aus beidem. In jedem Fall werden die Tarife konsistent über alle Kanäle angewendet. Damit bleiben Preisstrategien von Anfang bis Ende intakt – ohne Verzerrung durch Zwischenhändler.
Im Reseller-Modell werden CPOs nur selten direkt beim Ladevorgang bezahlt. Abrechnungen erfolgen oft erst Wochen oder Monate später – abhängig vom Zeitplan der Zwischenhändler. Für CPOs entstehen dadurch Liquiditätslücken und ein permanentes Ausfallrisiko: Bricht ein Zwischenhändler weg oder bestreitet Rechnungen, bleibt der Umsatz für bereits gelieferte Energie offen. Für ein kapitalintensives Infrastrukturgeschäft ist das ein strukturelles Risiko.
Diese Belastung trifft nicht nur CPOs. Viele CPMS-Anbieter vermarkten Infrastruktur im Namen der CPOs und übernehmen die Rechnungsstellung an Zwischenhändler direkt. In solchen Fällen tragen sie selbst das Risiko verspäteter oder ausbleibender Zahlungen. Wenn auf Intermediär-Ebene der Cashflow versiegt, geraten CPMS-Anbieter in eine Zwickmühle: Entweder sie verzögern die Auszahlungen an ihre CPO-Kunden – was Beziehungen belastet – oder sie tragen das Risiko selbst. Beide Optionen sind nicht nachhaltig – und beide sind direkte Symptome eines fehlerhaften Settlement-Modells.
Im Plattformmodell wird die Abrechnung radikal vereinfacht. Jede Transaktion erzeugt zum Zeitpunkt der Zahlung ihre eigene Rechnung – mit korrekter Mehrwertsteuerbehandlung direkt an der Quelle. Damit entfallen Unklarheiten über Reseller-Status oder Zuständigkeiten. Da das Clearing in Echtzeit erfolgt, kann der gesamte Prozess voll automatisiert werden. Wochenlange manuelle Abstimmungsarbeit wird durch sofortige, exakte Abrechnungen ersetzt.
Durch Pre-Authorisations sind die Gelder bereits vor Beginn der Ladesession gesichert. So lassen sich Verluste durch gestohlene oder kopierte RFID-Karten, geteilte App-Zugangsdaten oder unautorisierte Ladevorgänge verhindern. Selbst in Ausnahmefällen werden betrügerische Aktivitäten gestoppt, bevor nennenswerte Energiemengen abgegeben werden.
Ein deutlicher Unterschied zum Reseller-Modell, bei dem Betrugsfälle oft erst bei der monatlichen Abstimmung auffallen – und damit viel zu spät, um noch wirksam reagieren zu können.
Eine kommerzielle Interoperabilitätsschicht kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten darauf vertrauen, dass sie nicht genutzt wird, um die Geschäftsinteressen einzelner Marktteilnehmer durchzusetzen. Das heutige Reseller-Modell ist genau deshalb toxisch: Die Preishoheit liegt bei Intermediären, die eigene Umsatzinteressen verfolgen – oft im direkten Widerspruch zu den Auslastungszielen der CPOs oder den Erschwinglichkeitszielen der OEMs.
Cariqa ist von Grund auf neutral. Wir sind weder von Energieversorgern, CPOs, OEMs noch EMPs finanziert oder abhängig. Wir betreiben keinen eigenen Vertriebskanal, haben kein Energieprodukt für den Heimmarkt, das wir quervermarkten könnten und verfolgen keine versteckten Absichten, Kunden von einem Anbieter zum anderen umzuleiten. Wir sind auch kein CPMS-Anbieter und bieten keine Aggregationsservices an – wir haben also keinerlei Eigeninteresse, technische Verbindungen oder Datenflüsse in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Genau diese Unabhängigkeit macht uns zu einem glaubwürdigen Orchestrator: Wir können kommerzielle Anreize zwischen CPOs, OEMs, Flotten und Serviceanbietern ohne das Risiko von Channel-Konflikten ausrichten..
In einem Markt, in dem neue Anbieter oft von großen Energieversorgern unterstützt werden, parallel eigene Stromvertriebe betreiben oder Plattform-Funktionalitäten mit CPMS- oder Aggregationsangeboten bündeln, ist Neutralität kein „nice to have“, sondern die entscheidende Grundlage für ein System, das dem gesamten Ökosystem dient – und nicht den strategischen Interessen einzelner Anteilseigner.
Wir haben nicht mit Theorie angefangen, sondern mit Beweisen. Der erste Schritt auf dem Weg von Cariqa war es, unser Plattformmodell direkt in die Cariqa App zu integrieren. Nicht, um ein weiterer EMP zu werden, sondern um eine vollständig eigenständige Umgebung zu schaffen, in der wir das Modell End-to-End betreiben konnten – „eat your own dog food“, bevor wir es anderen anbieten.
In diesem kontrollierten Setup hielten wir die komplette Prozesskette in der Hand: CPOs legten ihre Tarife im Cariqa Command Center fest, die Preise erschienen sofort in der App, Fahrerinnen und Fahrer zahlten, und die Abrechnung erfolgte in Echtzeit. Wir arbeiteten mit großen, mittelgroßen und kleinen CPOs zusammen, holten direktes Feedback ein, identifizierten potenzielle Probleme, bevor sie skalieren konnten und validierten das Modell unter echten Marktbedingungen.
Das Ergebnis? 100 % Verfügbarkeit, null Probleme bei der Tarifauflösung und null Betrug. Preisgestaltung, Settlement und Compliance liefen vollständig synchron. Das war keine Theorie auf dem Papier – das war das Plattformmodell, das in der realen Welt funktioniert.
Mit wachsender Bekanntheit kamen von unseren Kunden und Nutzerinnen neue Wünsche: Sie wollten die Cariqa Plattform auch jenseits der App einsetzen. Besonders gefragt war eine Lösung, um harmonisiert und transparente Preise auch beim Ad-hoc-Laden vor Ort anbieten zu können – ohne Abstriche bei Geschwindigkeit, Nutzererlebnis oder Compliance.
Genau hier setzt Cariqa Go an. Ab sofort verfügbar, ist Cariqa Go eine AFIR-konforme Ad-hoc-Ladelösung, die das schnellste und nahtloseste QR-basierte Zahlungserlebnis am Markt bietet. Für Plattform-Kunden entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. Fahrerinnen und Fahrer profitieren von dynamischen Tarifen und können direkt am Ladepunkt per QR-Code bezahlen – Kartenterminals folgen in Kürze.
Beide Zahlungsoptionen bieten denselben Preis, den man auch in digitalen Kanälen findet – es gibt also keinen „Strafaufschlag“ mehr je nach gewählter Zahlungsmethode. Egal ob ein Fahrer „Tap & Go“ vor Ort bevorzugt oder jede Ladung digital nachverfolgen möchte: Cariqa Go macht es gleich schnell, gleich fair und gleich compliant – alles auf Basis desselben Plattformmodells, das bereits im Markt bewiesen und erprobt ist.
Doch für uns ist das nur der Anfang. Eine Plattform ist keine Plattform, solange sie in einer einzigen App gefangen bleibt. Ihre wahre Stärke entfaltet sie, wenn sie nach außen wächst – wenn andere genauso leicht darauf aufbauen können, als wäre es ihre eigene.
Was wäre, wenn das Plattformmodell E-Auto-Laden genau dort verfügbar machen könnte, wo Fahrerinnen und Fahrer ohnehin schon sind – in OEM-Apps, im In-Car-Infotainment, in Flottenlösungen, Mietwagen-Apps oder bei Pannenhilfsdiensten – ohne sie in eine zusätzliche Oberfläche zu zwingen?
Und was wäre, wenn CPOs über genau diese Touchpoints eine direkte kommerzielle Beziehung zu den Fahrern aufbauen könnten – ganz ohne EMPs als Gatekeeper?
Und schließlich: Was wäre, wenn Anbieter diese Services nicht nur ohne Zusatzkosten bereitstellen könnten, sondern sogar neue Umsätze damit generieren – während ihre Kunden gleichzeitig volle Preistransparenz genießen?
Genau das macht Cariqa Connect möglich. Während die Plattform den CPOs volle Kontrolle über ihre kommerzielle Strategie gibt, eröffnet sie gleichzeitig neue Chancen für die andere Seite des Ökosystems: Unternehmen, die Laden nahtlos in ihr Kundenerlebnis integrieren wollen.
Für Unternehmen, die schnell starten möchten, ermöglichen Connect Links innerhalb weniger Tage E-Laden – ganz ohne Programmierung. Karten-Apps, Preisvergleichsplattformen oder andere Services, die bereits Ladepunkte anzeigen, können mit sicheren Connect Links sofort Zahlungen aktivieren.
Fahrerinnen und Fahrer tippen einfach, zahlen und laden – ohne App-Download oder App-Clip. Für Anbieter ist dies der schnellste Weg, Ladepunkt-Sichtbarkeit in einen nahtlosen Service zu verwandeln, der bei jeder Transaktion Umsatz generiert.
Für tiefere, native Integrationen bietet die Connect API ab 2026 eine neue Dimension. Damit können digitale Produkte wie OEM-Apps, In-Car-Infotainment, Flottenportale, Mietwagen-Apps oder Mobilitätsdienste Ladefunktionen direkt integrieren. Kein EMP-Setup, keine überteuerten White-Label-Lösungen, keine versteckten Aufschläge.
Die Integration dauert Wochen, nicht Monate oder Jahre. Und sobald sie live ist, läuft sie ohne operativen Zusatzaufwand: Preisgestaltung, Zahlungen, Settlement und sogar Kundensupport übernimmt Cariqa.
So wie Stripe den Zahlungsverkehr revolutioniert hat und Twilio die Telekommunikation, transformiert die Connect API das Laden von E-Autos – sie beseitigt Gatekeeper und unnötige Komplexität, sodass Laden dort stattfinden kann, wo Fahrerinnen und Fahrer ohnehin schon sind.
Während sich unsere Plattform durch Cariqa Go und Connect nach außen öffnet, bleibt die App, mit der alles begann, ein wichtiger Teil unserer Strategie. Unter dem neuen Namen Cariqa Drive wird sie Fahrerinnen und Fahrer weiterhin direkt bedienen – mit dem, was viele als die vollständigste und benutzerfreundlichste Lade-App am Markt ansehen.
Doch Cariqa Drive ist mehr als nur eine Fahrer-App. Sie ist unser Testfeld: der Ort, an dem neue Funktionen zuerst starten, unter realen Bedingungen validiert und kontinuierlich verbessert werden, bevor sie über die Plattform auch Partnern zur Verfügung stehen. So stellen wir sicher, dass wir unsere eigenen Abläufe permanent End-to-End prüfen – und dass das Nutzererlebnis stets auf höchstem Niveau bleibt.
Vor allem aber ist Cariqa Drive auch ein kommerzieller Touchpoint für CPOs, die keinen eigenen EMP betreiben und dennoch einen direkten digitalen Kanal zu E-Autofahrern aufbauen möchten. Für andere dient sie als Referenzerlebnis: ein Benchmark dafür, wie nahtloses, transparentes und vertrauenswürdiges Laden aussieht, wenn unsere APIs in Drittprodukte integriert werden.
So ist Cariqa Drive gleichzeitig ein Service für Fahrer und ein Beweis für die Branche – ein praktisches Beispiel dafür, was das Plattformmodell leisten kann, wenn Preisgestaltung, Zahlungen und Nutzererlebnis perfekt ineinandergreifen.
Das ist der positive Kreislauf, den die Branche bisher vermisst hat. CPOs können ihre Preisstrategien endlich in großem Maßstab umsetzen, weil ihre Tarife unverändert in jeden Kanal fließen – ohne versteckte Aufschläge, ohne erzwungene Kanalabhängigkeit. OEMs und Flotten können ihr Angebot aufwerten, statt es mit aufgeblähten Reseller-Preisen oder unhandlichen White-Label-Lösungen zu verwässern. Fahrerinnen und Fahrer gewinnen Vertrauen, weil der Preis, den sie sehen, auch der Preis ist, den sie bezahlen – egal wo und wie sie laden.
Wenn die kommerziellen Anreize ausgerichtet sind, wird die Teilnahme attraktiv und nachhaltig. CPOs profitieren von schneller steigender Auslastung und kürzeren Amortisationszeiten. OEMs können öffentliche Ladeangebote selbstbewusst in ihre Kundenerlebnisse ohne Angst vor Preisdiskussionen einbinden. Flotten integrieren Laden, ohne Budgets in komplexe, wenig rentable Eigenlösungen zu versenken. Gerade für kommerzielle Flotten liegen die Vorteile auf der Hand: eine harmonisierte, transparente Kostenstruktur fürs Laden stärkt das TCO-Argument für E-Auto-Adoption – weit über ESG-Ziele hinaus.
Fahrer müssen nicht länger „Schatzsuche“ nach dem besten Tarif betreiben, weil es kein verstecktes Sonderangebot mehr gibt.
Man könnte es mit dem Kauf einer Milchpackung vergleichen: Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und der Preis hängt davon ab, welche Bank deine Karte ausgestellt hat oder ob du bar bezahlst. Das wäre gesellschaftlich inakzeptabel – doch genau so funktioniert Laden heute. Das Plattformmodell beendet diese Verzerrung: dieselbe Station, dieselbe Energie, derselbe Service, derselbe faire Preis – egal wo und wie bezahlt wird.
Die Massenadoption wird nicht allein durch technische Verbindungen ausgelöst. Roaming-Hubs haben bereits die Grundlage geschaffen, indem sie sicherstellen, dass Ladepunkte und Dienste technisch miteinander sprechen können. Der nächste Schritt ist Vertrauen: Anreize im gesamten Ökosystem so auszurichten, dass alle – von Infrastrukturbetreibern bis zu OEMs – auf einer kommerziell tragfähigen und transparenten Basis agieren können. Nur so lässt sich echte Skalierung erreichen, ohne Preise zu verzerren oder das Vertrauen der Nutzer zu untergraben.
Es ist Zeit für ein Modell, das für alle funktioniert.
Es ist Zeit, mit Cariqa zu bauen.